 Filmrezensionen, oder Filmkritiken, wie man sie auch gerne nennt, begleiten mich bereits seit ich mich für Filme interessiere. Angefangen über die in der Regionalzeitung abgedruckten Texte (meist von nicht-regionalen, freien Schreiberlingen), über die Inhaltszusammenfassungen inklusive Lobhudelei in den Textbeilagen zum Fastfood-Menü (meist via Copy&Paste aus den PR-Infos der Agenturen zusammengestückelt) bis hin zur oft unsachlich unsäglichen Kurzkritik in drei Zeilen plus Punktewertung die in sozialen Netzwerken gepostet werden.
Filmrezensionen, oder Filmkritiken, wie man sie auch gerne nennt, begleiten mich bereits seit ich mich für Filme interessiere. Angefangen über die in der Regionalzeitung abgedruckten Texte (meist von nicht-regionalen, freien Schreiberlingen), über die Inhaltszusammenfassungen inklusive Lobhudelei in den Textbeilagen zum Fastfood-Menü (meist via Copy&Paste aus den PR-Infos der Agenturen zusammengestückelt) bis hin zur oft unsachlich unsäglichen Kurzkritik in drei Zeilen plus Punktewertung die in sozialen Netzwerken gepostet werden.
Das Medium ist – wie so oft – egal. Der Text, die Rezension an sich muss etwas leisten können, egal wo er erscheint. Es ist vielleicht ein reiner Zufall, aber keineswegs unwichtig, dass ich schon in einer sehr frühen Phase meines unkoordinierten Hürdenlaufs durch die Medienwelt auf einen Vorgesetzten traf, der mir sagte: „Ich hasse Filmkritiker“.
Die augenscheinliche Autorität der Meinung
Das gab mir zu denken. Dieses Phänomen wird selten erwähnt, ist aber – so glaube ich – weit verbreitet. Wer lässt sich schon gerne sagen, was man gut finden soll? So werden Filmkritiker jedenfalls oft wahrgenommen, als leicht arrogante, eigentlich unqualifizierte Besserwisser, die an Lieblingsfilmen rummeckern und sogar gute Filme in ihrer Leistung schmälern wollen. Dabei kann, darf und soll der Kritiker nicht diktieren was dem Leser gefallen mag – auch wenn sein Ton das oft suggeriert.
Schnell ist man versucht, dem Kritiker zu unterstellen, dass er absichtlich alles schlechtfinden will, oder doch mindestens versucht überall etwas Negatives zu finden, statt den Film als solchen zu akzeptieren und zu versuchen ihn zu genießen. Nur ein abgrundtief bitterer Zyniker, jemand der vom Leben enttäuscht ist, kann fortweg solch bitterböse Kritiken schreiben, oder? Enttäuscht, nicht selbst Filme drehen zu dürfen, enttäuscht, dass niemand auf seine Meinung hört oder enttäuscht, weil selbst Jugendidole der cineastischen Geschmacksbildung mittlerweile Minderwertiges produzieren.
Manchmal stimmt das.
 Es ist kein Geheimnis, dass ich der englischen Sprache nicht ohnmächtig bin. Ergeben hat sich dies stets von anderen Interessen ausgehend: Im Alter von acht Jahren habe ich den ersten Teil von „Leisure Suit Larry“ auf einem 286er mit monochromen Röhrenbildschirm gespielt. Dort lernte ich so unverzichtbare Vokabeln wie „sit“, „remote control“ und „beer“ (das Passwort ist übrigens „Ken sent me“). Über viele Zwischenschritte und natürlich Schulenglisch reichte es dann irgendwie bis zum Englischstudium. In der Rubrik „Vorsicht Englis[c]h!“ konzentriere ich mich auf ausschließlich englischsprachige Quellen, mein Text bleibt jedoch in deutscher Sprache. Daher: „No prior experience necessary“. Dem Titel der Seite entsprechend, beschäftigen wir uns heute mit dem britischsten, ähm… chinesischsten aller Getränke: Tee.
Es ist kein Geheimnis, dass ich der englischen Sprache nicht ohnmächtig bin. Ergeben hat sich dies stets von anderen Interessen ausgehend: Im Alter von acht Jahren habe ich den ersten Teil von „Leisure Suit Larry“ auf einem 286er mit monochromen Röhrenbildschirm gespielt. Dort lernte ich so unverzichtbare Vokabeln wie „sit“, „remote control“ und „beer“ (das Passwort ist übrigens „Ken sent me“). Über viele Zwischenschritte und natürlich Schulenglisch reichte es dann irgendwie bis zum Englischstudium. In der Rubrik „Vorsicht Englis[c]h!“ konzentriere ich mich auf ausschließlich englischsprachige Quellen, mein Text bleibt jedoch in deutscher Sprache. Daher: „No prior experience necessary“. Dem Titel der Seite entsprechend, beschäftigen wir uns heute mit dem britischsten, ähm… chinesischsten aller Getränke: Tee. Am Ende einer jeden Woche blicke ich auf meinen Browser und stelle fest: Ah, da kommen die Leistungseinbußen her. Unzählige Tabs sind offen und mein Computer hasst mich dafür. In den Tabs gibt es jedoch Lesens-, Sehens- und Hörenswertes. Einiges davon möchte ich hier gesammelt mit Euch teilen.
Am Ende einer jeden Woche blicke ich auf meinen Browser und stelle fest: Ah, da kommen die Leistungseinbußen her. Unzählige Tabs sind offen und mein Computer hasst mich dafür. In den Tabs gibt es jedoch Lesens-, Sehens- und Hörenswertes. Einiges davon möchte ich hier gesammelt mit Euch teilen. Moin Kinners, schön, dass Ihr hergefunden habt. Schuhe bitte ausziehen, Mantel anlassen? Ja, ich weiß, bei mir ist immer etwas kühl. Nehmt Platz, möchtet Ihr ’ne Tasse Tee?
Moin Kinners, schön, dass Ihr hergefunden habt. Schuhe bitte ausziehen, Mantel anlassen? Ja, ich weiß, bei mir ist immer etwas kühl. Nehmt Platz, möchtet Ihr ’ne Tasse Tee?

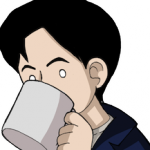

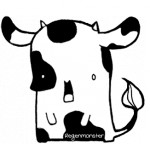 Alle Zeichnungen von Raine aka Regenmonster
Alle Zeichnungen von Raine aka Regenmonster